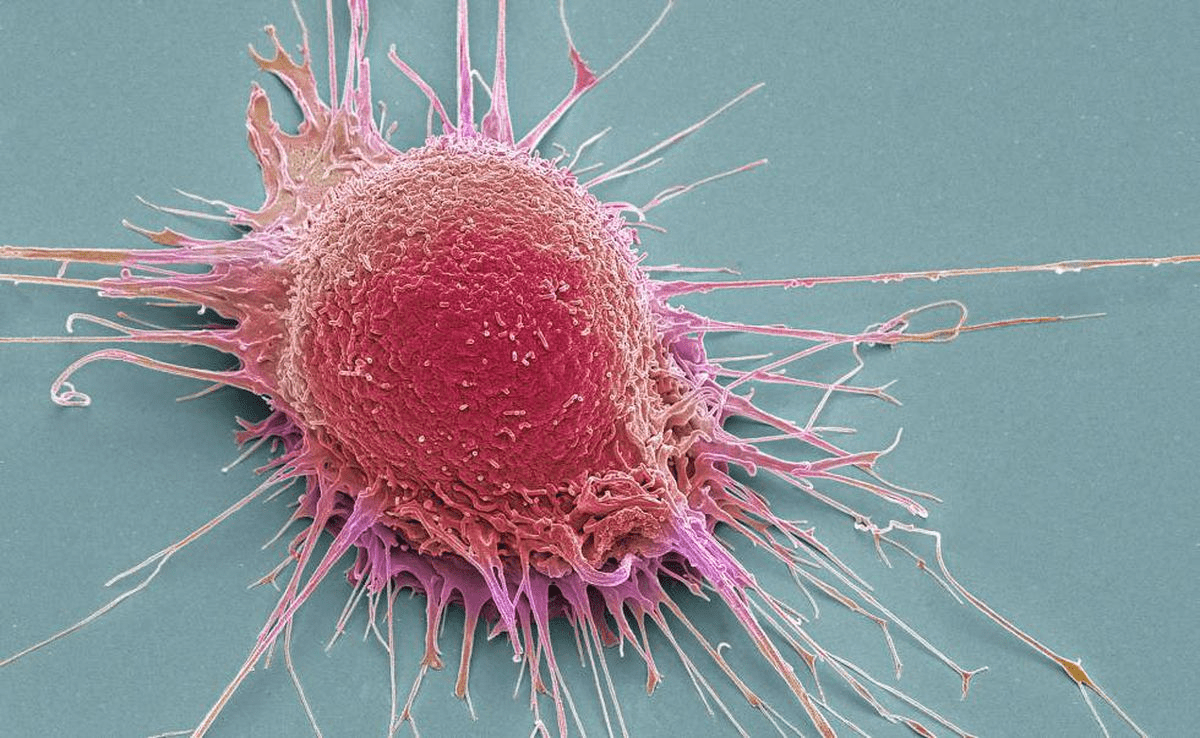Beth Shapiro, leitende Wissenschaftlerin des Projekts zur Wiederbelebung der Mammuts: „Es ist die letzte Chance für viele Arten, die kurz vor dem Aussterben stehen.“

Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten ist keine Utopie mehr. Nach jahrzehntelanger Forschung an Universitäten ist es einem US-amerikanischen Unternehmen mit einem Wert von rund 10 Milliarden Euro gelungen, ein Tier wiederzubeleben – auch wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft davon noch nicht überzeugt ist. In diesem Jahr gab Colossal die Entwicklung von Wollmäusen mit Mammutgenen, von Riesenwölfen mit seit über 10.000 Jahren ausgestorbenen Genen sowie Fortschritte in der künstlichen Befruchtung von Vögeln bekannt, um den Dodo, den flugunfähigen Vogel, der im 17. Jahrhundert durch den Menschen und seine eingeschleppten Tiere ausstarb, wieder zum Leben zu erwecken. Das nächste Ziel ist die Wiederbelebung des Wollhaarmammuts mithilfe des Asiatischen Elefanten als Grundlage.
Die leitende Wissenschaftlerin von Colossal ist Beth Shapiro, eine 49-jährige amerikanische Zoologin. Nachdem sie ihre Karriere als Journalistin begonnen und sich später zu einer führenden Forscherin im Bereich alter DNA an Universitäten entwickelt hatte, leitete sie die verschiedenen Forschungsteams, die an der Wiederbelebung der oben genannten Tiere sowie des Tasmanischen Tigers und des Neuseeländischen Moas arbeiten.
Für Shapiro verkörpern die Riesenwölfe die erste erfolgreiche Wiederbelebung einer ausgestorbenen Art in der Geschichte. Die drei Exemplare wurden aus Zellen moderner Grauwölfe erzeugt, in die 20 genetische Veränderungen eingeführt wurden, die für den ausgestorbenen Hund (Canis dirus) charakteristisch sind. Kritiker sehen in diesen Tieren nichts weiter als Grauwölfe, die robuster, größer und weißer gemacht wurden; sie ähneln ihren ausgestorbenen Verwandten, sind aber nicht mit ihnen identisch . Viele Experten betonen, dass die einzige Möglichkeit, eine ausgestorbene Art wiederzubeleben, darin bestünde, Tiere aus ihrem gesamten Genom zu klonen – was unmöglich ist. Der Pyrenäen-Steinbock hat die zweifelhafte Ehre, den einzigen Teilerfolg auf diesem Gebiet des Klonens darzustellen: Das einzige Jungtier starb vor über 20 Jahren zehn Minuten nach der Geburt.
Die von Colossal verstandene Wiederbelebung ausgestorbener Arten ist anders, beinhaltet aber ebenfalls zahlreiche wissenschaftliche Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen: Massengenbearbeitung, Klonen und vor allem die Verwendung von Elefanten zur 22-monatigen Austragung der Nachkommen, ohne dass, wie Shapiro einräumt, irgendjemand weiß, ob alles funktioniert hat, bis sie geboren sind.
Die Idee dahinter ist, dass all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu beitragen werden, viele vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten. Die Gründer von Colossal sind der charismatische Harvard-Genetiker George Church und der Unternehmer Ben Lamm, die argumentieren, dass ihre Kreaturen durch Klimawandel und menschlichen Einfluss geschädigte Ökosysteme wiederherstellen können.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat die Firma Hunderte von Millionen Dollar von Vermögen wie denen von Paris Hilton, Peter Jackson und Thomas Tull, einem der Schöpfer von Jurassic World, eingesammelt.
Die Organisation plant, ihre Mammuts in Alaska und ihre Dodos auf Mauritius aufzuziehen. Die Riesenwölfe sind ein Jahr nach ihrer Geburt in einem geheimen Reservat in den USA weiterhin wohlauf. Künstliche Intelligenz und Drohnen werden ein wichtiges Überwachungsinstrument sein, um ein Entkommen der Tiere zu verhindern, erklären Shapiro und drei weitere Wissenschaftler von Colossal in einer kürzlich veröffentlichten Studie.
Viele Naturschützer stellen dieses Projekt infrage, da lebende Arten weiterhin geschützt werden können. Sie argumentieren außerdem, dass die Erforschung von Taubeneiern nicht mit der Erforschung von Elefanten vergleichbar sei. Führende Genetiker weisen darauf hin, dass keines der uns vorliegenden Genome ausgestorbener Arten vollständig ist und dass deren natürliches Verhalten und Lebensraum für immer verschwunden sind, weshalb man nicht von einer Wiederbelebung ausgestorbener Arten sprechen könne . Andere sehen darin potenzielle, nicht deklarierte industrielle Anwendungen oder gar ein Zeitvertreib für abgeklärte Milliardäre.
In einer wegweisenden Entscheidung hat die Internationale Union für Naturschutz (IUCN) ein Moratorium für Projekte der synthetischen Biologie, die das Genom wildlebender Arten verändern , abgelehnt – ein nahezu grünes Licht für die Projekte von Colossal.
Shapiro ist seit März letzten Jahres wissenschaftliche Leiterin von Colossal, nachdem sie von ihrem Paläogenomik-Labor an der University of California , Santa Cruz, dorthin gewechselt war. Trotz der Kontroverse genießt sie weiterhin hohes Ansehen in ihrem Fachgebiet und veröffentlicht hochrangige Studien, wie beispielsweise die kürzlich erfolgte genetische Rettung von Bakterien, die vor über einer Million Jahren in Mammuts lebten. Die Wissenschaftlerin beantwortet die Fragen von EL PAÍS per Videokonferenz von ihrem Wohnsitz in Kalifornien aus.
Frage: Was haben Sie empfunden, als Sie die riesigen Wölfe zum ersten Mal gesehen haben?
Antwort: Ich hatte furchtbare Angst, dass es nicht funktionieren würde. In diesem Fall haben wir kein Gen von Riesenwölfen verwendet, da es mit Blindheit und Taubheit in Verbindung gebracht wird. Wir haben Gene für weißes Fell verwendet, das charakteristisch für Grauwölfe ist. Meine erste Frage, als ich sie sah, war, ob sie weiß waren. Und ich dachte: Verdammt, wir haben es geschafft, es funktioniert! Jetzt sehen wir, dass auch die anderen Veränderungen – größere Körpergröße, mehr Muskeln, sehr dichtes Fell – eingetreten sind. Es ist fantastisch, an vorderster Front bei der Entwicklung dieser Werkzeuge dabei zu sein, die dazu beitragen können , das Aussterben anderer Arten zu verhindern.

F: Wie ähnlich sind diese Wölfe Tieren, die vor 10.000 Jahren lebten?
R. Riesenwölfe lebten in Lebensräumen während Eiszeiten und Warmzeiten, die wir Menschen völlig verändert haben. Sie waren jedoch sehr anpassungsfähige Tiere, und ich bin sicher, dass der Ort, an dem wir sie jetzt aufziehen, ihrem einstigen Lebensraum ähnelt. Ich glaube nicht, dass wir viel über ihr Verhalten erfahren werden, da sie von Pflegern aufgezogen wurden. Wir haben zwei Männchen und ein Weibchen. Wir haben sie noch nicht fortpflanzen lassen, aber wir planen, in Zukunft Gruppen von etwa sechs Tieren zu bilden und sie irgendwann in die Wildnis zu entlassen. Wenn sie wilder werden, werden wir wahrscheinlich beobachten können, wie sich ihre größere Statur, ihre Muskulatur und andere körperliche Merkmale auf ihr Verhalten auswirken, beispielsweise bei der Jagd.
F: Und das nächste Ziel ist das Wollhaarmammut?
R. Ja. Unser Mammut -Team macht große Fortschritte. Wir konzentrieren uns auf die Wolligkeit und die Kälteanpassung. Elefanten haben deutlich weniger Haarfollikel, daher erforschen wir, wie wir deren Anzahl erhöhen und sie dazu bringen können, längeres, charakteristischeres Haar zu produzieren. Wir identifizieren außerdem genetische Varianten, die mit anderen Mammutmerkmalen zusammenhängen: längeren Stoßzähnen und kürzeren Ohren und Schwänzen. Das Team für Genomtechnik entwickelt ein neues Werkzeug, Multiplex, um Hunderte von genetischen Veränderungen gleichzeitig in einer einzigen Elefantenzelle vorzunehmen. Bei den Riesenwölfen mussten wir nur 20 Gene verändern, aber diesmal müssen wir Hunderte verändern.
F: Was meinen Sie?
R. Sie und ich weisen etwa drei Millionen Unterschiede in unseren Genomen auf, sind aber beide gleichermaßen Menschen . Wenn ich herausfinden kann, welche Veränderungen für die einzelnen Merkmale verantwortlich sind, die wir wiederherstellen möchten, ist es unser Ziel, so wenige Veränderungen wie möglich vorzunehmen. Wir arbeiten mit einem Elefantengenom, und jede Veränderung birgt ein zusätzliches Risiko. Es geht nicht darum, das gesamte Genom eines Mammuts zu reproduzieren, sondern darum, wichtige Merkmale von Mammuts in heutige Arten einzuführen.
F: Und wird dieses erste Mammut von einem asiatischen Elefanten geboren?
R.: Genau das ist der Plan. Gleichzeitig stehen wir kurz davor, die Entwicklung reprogrammierter Elefantenstammzellen bekanntzugeben. Diese könnten uns helfen, Spermien und Eizellen zu gewinnen, sodass wir sie nicht mehr lebenden Tieren entnehmen müssen. Ein anderes Team arbeitet an artenübergreifenden Klontechniken, um Zugang zu embryonalen Stammzellen zu erhalten. Außerdem verfeinern wir die bisher wenig entwickelten Techniken zur Eizellentnahme bei Elefanten. Wir stehen vor zahlreichen wissenschaftlichen Herausforderungen und gehen sie alle gleichzeitig an, um größtmögliche Fortschritte zu erzielen.
F: Wann erwarten Sie die Geburt des ersten Tieres?
R. Als das Unternehmen gegründet wurde, gaben Church und Lamm das Jahr 2028 als Ziel an; und unser Genomtechnik-Team ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Elefanten haben jedoch eine sehr lange Tragzeit von 22 Monaten. Das bedeutet, dass wir bis Ende 2026 alles über künstliche Befruchtung bei Elefanten wissen müssen. Ich glaube, es ist möglich, aber wir wollen kein Risiko eingehen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, das Mammut in drei Jahren wiederzubeleben, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
F: Warum wollen sie ausgerechnet diese fünf Tiere wiederbeleben?
Viele Umweltbedingungen verändern sich so schnell, dass die natürliche Selektion nicht mehr mithalten kann . Im Idealfall würden wir die Ausbreitung stoppen und den Arten die Chance geben, die sie verdienen. Doch dafür ist es zu spät. Der menschliche Einfluss ist zu groß, daher brauchen wir neue Instrumente. Dazu gehört auch, die Wechselwirkung zwischen ausgestorbenen Arten und Ökosystemen wiederherzustellen und sie so widerstandsfähiger zu machen. Stellen Sie sich vor, wir könnten die DNA des hawaiianischen Honigfressers (einer vom Aussterben bedrohten Vogelgruppe) so verändern, dass er gegen Malaria resistent wird – eine Krankheit, die der Mensch durch Mücken eingeschleppt hat. Ähnliches geschieht beim Schwarzfußfrettchen oder beim Vaquita-Schweinswal . Dadurch könnten sie trotz menschlicher Aktivitäten in ihrem Lebensraum weiterleben. Diese Auswahl an Arten – zwei Plazentatiere, ein Beuteltier und zwei Vögel – zeigt, dass wir Instrumente entwickeln können, die auf den gesamten Stammbaum des Tierlebens anwendbar sind und Arten vor dem Aussterben bewahren. In vielen Fällen ist dies die letzte Chance für Arten, die kurz vor dem Verschwinden stehen. Wir brauchen diese Instrumente dringend, um eine Zukunft zu gestalten, in der Biodiversität und menschliche Präsenz nicht unvereinbar sind.
F: Welchen Nutzen hätten Elefanten, denen Mammutgene hinzugefügt wurden?
Im Permafrost [der dauerhaft gefrorenen Bodenschicht in den Polregionen] verbreiten sie Samen und Nährstoffe , lockern den Boden auf, verändern die Vegetation und stärken das Ökosystem. Im Winter, wenn diese Tiere auf Nahrungssuche gehen, schieben sie den Schnee beiseite und legen so Bodenflächen frei. Im Frühling wachsen in diesen Bereichen verschiedene Pflanzen und bilden ein Mosaik, in dem andere Pflanzenarten gedeihen können. Mammuts waren die Gestalter ihrer Ökosysteme, genau wie Elefanten es heute in ihren sind.
F : Was passiert, wenn etwas schiefgeht, zum Beispiel, wenn sie entkommen?
R. Ich denke, wir sind durchaus in der Lage, Risiken einzuschätzen. Seit Anbeginn der Menschheit haben wir die evolutionäre Entwicklung der meisten uns bekannten Arten beeinflusst. Wir haben den Grauwolf in Chihuahuas und Deutsche Doggen verwandelt; wir haben aus Teosinte alle möglichen Maissorten gemacht. Heute entscheiden wir, wo, wie und wie viele bedrohte Arten wir am Leben erhalten, und nennen das Naturschutz. Das ist natürlich wichtig. Aber wir müssen uns verbessern. Manche behaupten, diese neuen Instrumente seien gefährlich, doch sie vergessen, dass ihre Nichtanwendung Konsequenzen haben wird – in einer Welt, in der die Aussterberate so hoch ist wie nie zuvor in der Geschichte und im Fossilienbestand.
F: Es gibt führende Experten für alte DNA, die bestreiten, dass es sich hierbei um wiederbelebte Arten handelt. Was ist Ihre Meinung dazu?
R. Wir Menschen definieren Arten und sind dann mit ihnen nicht einverstanden. Aber wissen Sie, wem das alles egal ist? Ökosystemen, denen die Funktion fehlt, die diese Tiere erfüllen können. Ob man sie nun Riesenwölfe oder Wölfe 2.0 nennt, ist letztendlich irrelevant. Für uns sind sie Wölfe, wenn sie sich wie Wölfe verhalten und ihre Rolle erfüllen.
F: Und was halten Sie von Naturschützern, die sagen: Zuerst sollten wir die gegenwärtigen Arten retten?
R.: Das ist kein Dilemma. Wir können beides tun. Wir wollen lediglich einen neuen Weg finden, um bestimmten Arten das Überleben vor dem Menschen zu ermöglichen. Wir brauchen mehr, nicht weniger Hilfsmittel.
F: Wie werden Sie all diese wissenschaftlichen Anstrengungen rentabel gestalten?
R. Wir entwickeln viele interessante Technologien, die wir Naturschutzprojekten kostenlos zur Verfügung stellen. Viele dieser Fortschritte werden wir aber auch patentieren lassen, und ich denke, der größte Gewinn wird aus dem Verkauf im Gesundheitswesen stammen. Wir haben ein 17-köpfiges Team, das eine künstliche Gebärmutter entwickelt, um auf Elefanten verzichten zu können. Es liegt aber auf der Hand, dass ein solcher Fortschritt auch Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzung und Gesundheit haben wird. Es gibt viele Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen.
F: Könnte diese Technologie auch zur Wiederbelebung ausgestorbener menschlicher Arten, wie zum Beispiel der Neandertaler , eingesetzt werden?
R.: Das ist die ethische Grenze, die ich nicht überschreiten möchte. Wenn man mit Menschen arbeitet, gibt es eine einzigartige und grundlegende Voraussetzung: die informierte Einwilligung der Patienten. Sie müssen verstehen, was das Experiment beinhaltet, und ihre Zustimmung geben. Wir, Neandertaler und Denisova-Menschen sind alle gleichermaßen Menschen, und ich sehe keine Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Wiederbelebung zu erhalten. Diese Frage ist aus theoretischer Sicht faszinierend , aber wir werden sie nicht umsetzen.
EL PAÍS